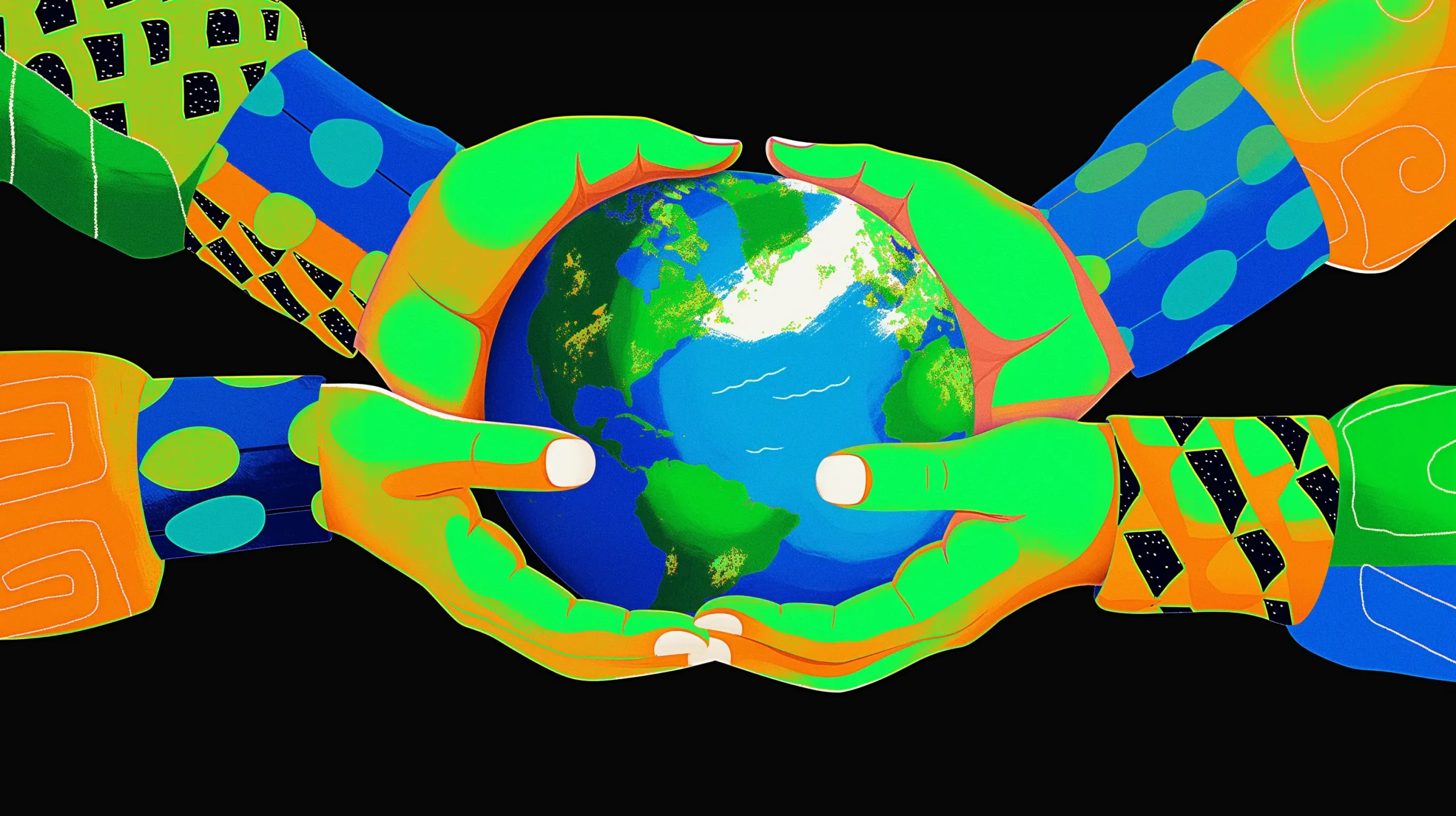Ableismus ist ein Begriff, der die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen beschreibt. Der Ausdruck leitet sich vom englischen Wort „ableism“ ab, das sich aus „to be able“ (fähig sein) und der Endung „-ism“ zusammensetzt. Ähnlich wie bei anderen Formen der Diskriminierung, wie Rassismus oder Sexismus, bezeichnet Ableismus ein System von Praktiken, Institutionen und Überzeugungen, das soziale Beziehungen formt und ein geschlossenes Weltbild schafft.
Der Ursprung des Begriffs liegt in der US-amerikanischen Behindertenbewegung der 1970er-Jahre, auch bekannt als Disability Rights Movement. Seitdem hat sich der Begriff in der Fachwelt etabliert, ist aber im alltäglichen Sprachgebrauch bisher nicht weit verbreitet. Um die Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen genauer benennen und für diese Art der Diskriminierung sensibilisieren zu können, ist es wichtig, den Begriff Ableismus stärker in die Alltagssprache zu integrieren.
Formen des Ableismus und ihre Auswirkungen
Ableismus kann sich in verschiedenen Formen äußern. Eine häufige Form ist die Ungleichbehandlung eines Menschen aufgrund seiner Behinderung, was als Abwertung der Person bezeichnet wird. Eine weitere Form ist die sogenannte Aufwertung, bei der ein Mensch mit Behinderung die Rückmeldung bekommt, dass er trotz seiner Behinderung zu etwas Bestimmtem fähig sei. Beide Formen stellen eine Diskriminierung dar und können negative Auswirkungen auf die betroffenen Personen haben.
Die Folgen von Ableismus können für die Betroffenen gravierend sein. Sie können zu Verunsicherung, Identitätsproblemen und sozialem Rückzug führen. Menschen mit Behinderungen müssen oft damit rechnen, die Ausnahme zu sein und können nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Planung von Kulturveranstaltungen, wo Barrierefreiheit noch immer nicht zur Normalität gehört.

Ableismus in Sprache und Medien
Ein wichtiger Aspekt des Ableismus ist seine Manifestation in der Sprache. Viele Begriffe und Formulierungen, die im Alltag ohne Hintergedanken verwendet werden, können Menschen mit Behinderungen diskriminieren. Beispiele hierfür sind Metaphern wie „emotional verstümmelt“, Witze, die jemanden als „hysterisch lustig“ bezeichnen, oder Euphemismen wie „besondere Bedürfnisse“.
Auch in den Medien ist Ableismus weitverbreitet. Die Darstellung von Menschen mit Behinderungen erfolgt oft klischeehaft und nicht auf Augenhöhe. In Filmen werden Rollen von Menschen mit Behinderungen häufig von nicht-behinderten Schauspieler*innen gespielt, während Schauspieler*innen mit Behinderungen es schwer haben, Rollenangebote zu bekommen, insbesondere solche, bei denen ihre Person und nicht die Behinderung im Vordergrund steht.
Struktureller Ableismus und gesellschaftliche Verankerung
Ableismus ist tief in gesellschaftlichen Strukturen verankert. Dies zeigt sich in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt, öffentlichen Räumen und im Gesundheitswesen. Menschen mit Behinderungen stoßen oft auf strukturelle Barrieren, die ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren.
Ein Beispiel für strukturellen Ableismus ist die mangelnde Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden oder im öffentlichen Personenverkehr. Auch im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt sind Menschen mit Behinderungen oft benachteiligt, da ihre Fähigkeiten unterschätzt oder nicht anerkannt werden.
Internalisierter Ableismus und seine Folgen
Ein oft übersehener Aspekt des Ableismus ist der internalisierte Ableismus. Wenn Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten ständig mit der Bewertung ihrer (Un-)Fähigkeiten von außen konfrontiert sind, kann dies dazu führen, dass sie selbst beginnen, ihre Fähigkeiten in Frage zu stellen. Internalisierter Ableismus kann sich in Form von Leistungsdruck, Scham, Schuldgefühlen, Selbstzweifeln und einem Gefühl der Ausgrenzung äußern.
Strategien gegen Ableismus und Wege zur Inklusion
Um Ableismus entgegenzuwirken, sind verschiedene Strategien notwendig. Für Menschen, die von Ableismus betroffen sind, kann der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein, um Erfahrungen zu teilen und sich weniger allein zu fühlen. Es ist wichtig, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken und einen Anspruch auf Wertschätzung zu entwickeln.
Auf gesellschaftlicher Ebene ist es notwendig, Bewusstsein für Ableismus zu schaffen und Strukturen zu verändern. Dies beinhaltet die Verbesserung der Barrierefreiheit, die Förderung inklusiver Bildung und Arbeitsmöglichkeiten sowie die Bekämpfung von Vorurteilen und Stereotypen in den Medien und der Öffentlichkeit.
Initiativen wie das Berliner Netzwerk Berlinklusion setzen sich für die Zugänglichkeit im Kunst- und Kulturbetrieb ein und arbeiten daran, Ableismus im Kulturbetrieb abzubauen. Solche Initiativen können als Vorbild für andere Bereiche dienen und zeigen, wie Inklusion in der Praxis umgesetzt werden kann.
Fazit: Ableismus erkennen und überwinden
Ableismus ist ein komplexes gesellschaftliches Problem, das in vielen Bereichen des täglichen Lebens auftritt. Um es zu überwinden, ist es wichtig, dass sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderungen für das Thema sensibilisiert werden. Nur durch ein gemeinsames Bewusstsein und aktives Handeln kann eine inklusive Gesellschaft geschaffen werden, in der alle Menschen unabhängig von ihren Fähigkeiten gleichberechtigt teilhaben können.
Die Überwindung von Ableismus erfordert einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel. Dieser beginnt bei der Sprache, setzt sich fort in der Gestaltung öffentlicher Räume und Institutionen und muss letztendlich zu einer grundlegenden Veränderung der Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderungen führen. Nur so kann eine Gesellschaft entstehen, die die Vielfalt menschlicher Fähigkeiten und Lebensweisen als Bereicherung versteht und wertschätzt.